Prozesse in der Produktentwicklung verbessern: Fünf erprobte Best Practices
7.11.2025
18
Min. Lesedauer

Warum stabile Prozesse der Schlüssel zum Erfolg sind
Eine gute Produktidee allein reicht nicht aus. Erst durch stabile, transparente und abgestimmte Prozesse wird aus einer Idee ein marktreifes und wirtschaftlich erfolgreiches Produkt. Denn selbst die innovativste Lösung kann scheitern, wenn sie in einem ineffizienten Umfeld entwickelt wird. Wenn Zuständigkeiten unklar, Informationen verstreut oder Entscheidungen verzögert sind, leidet nicht nur der Projekterfolg, sondern auch Motivation, Innovationskraft und der Markterfolg. Teams arbeiten aneinander vorbei, wichtige Anforderungen werden übersehen, und wertvolle Zeit wird mit Abstimmungen, Nacharbeiten oder Fehlerkorrekturen vergeudet.
Optimierte Prozesse hingegen schaffen die Grundlage für produktive, zielgerichtete Entwicklung. Sie geben Orientierung, ermöglichen eine verlässliche Planung und machen Schnittstellen zwischen Abteilungen handhabbar. Statt Konflikte auszutragen, können sich Teams auf das konzentrieren, was wirklich zählt: innovative Lösungen zu schaffen, die den Kundennutzen in den Mittelpunkt stellen.
Stabile Prozesse sorgen für:
- Klare Verantwortlichkeiten und schnelle Entscheidungswege: Jeder weiß, wofür er zuständig ist, und wer im Zweifel das letzte Wort hat. Dies reduziert Reibungen und vermeidet unnötige Abstimmungsschleifen.
- Effiziente Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg: Durch definierte Schnittstellen und eine gemeinsame Sprache im Projekt werden Missverständnisse reduziert und Silodenken aufgebrochen.
- Höhere Transparenz und bessere Planbarkeit: Alle Beteiligten haben den gleichen Wissensstand. Dadurch werden Fortschritt, Risiken und Abhängigkeiten sichtbar, was eine vorausschauende Steuerung erlaubt.
- Weniger Reibungsverluste und kostspielige Schleifen: Durch klare Abläufe und saubere Übergaben werden Fehler frühzeitig erkannt und korrigiert, statt sich bis zum Ende durchzuziehen.
Kurz gesagt: Stabile Prozesse sind kein Selbstzweck, sondern die Voraussetzung dafür, dass Produktentwicklung effizient, zielgerichtet und kundenorientiert funktioniert. Dies gilt gerade auch in einem Umfeld, das sich ständig verändert.
Best Practice 1: Anforderungen als gemeinsame Basis verstehen
Ein Großteil aller Fehlentwicklungen in der Produktentwicklung lässt sich auf unklare, unvollständige oder widersprüchliche Anforderungen zurückführen. Häufig fehlt es nicht an technischem Können oder Innovationsgeist, sondern am gemeinsamen Verständnis darüber, was genau entwickelt werden soll und warum. Unterschiedliche Vorstellungen, Missverständnisse oder implizite Annahmen führen dazu, dass Produkte am tatsächlichen Bedarf vorbeientwickelt werden.
Deshalb beginnt jede erfolgreiche Optimierung der Entwicklungsprozesse mit einem professionellen Requirements Management. Anforderungen bilden die verbindende Grundlage zwischen Kundenbedürfnis, technischer Umsetzung und Qualitätssicherung. Sie sind sozusagen der rote Faden im gesamten Projektverlauf.
Erfolgsfaktoren im Anforderungsmanagement:
- Systematisches und nachvollziehbares Erfassen: Anforderungen sollten nicht ad hoc oder aus dem Bauch heraus gesammelt werden, sondern anhand klarer Kategorien, Formate und Quellen. Nur so entsteht eine belastbare Informationsbasis.
- Frühe Einbindung aller relevanten Stakeholder: Je früher die verschiedenen Perspektiven, z. B. aus Vertrieb, Entwicklung, Qualitätssicherung oder Service, berücksichtigt werden, desto geringer ist die Gefahr späterer Korrekturschleifen.
- Zentrale, transparente Dokumentation: Mit geeigneten Tools lassen sich Anforderungen strukturiert erfassen, versionieren und allen Beteiligten zugänglich machen. Das reduziert Missverständnisse und sorgt für eine einheitliche Sicht.
- Klare Prozesse für Prüfung, Freigabe und Änderungen: Anforderungen sind lebendig. Umso wichtiger sind definierte Abläufe für die Bewertung, Genehmigung und Pflege, inklusive der Nachvollziehbarkeit aller Änderungen.
Ein professionell aufgesetztes Requirements Management schafft nicht nur Klarheit im Projekt, sondern auch Vertrauen zwischen den Beteiligten. Es schlägt die Brücke zwischen Vision und Umsetzung, zwischen Idee, Entwicklung und Test und ist damit ein zentrales Fundament für stabile und erfolgreiche Prozesse in der Produktentwicklung.
Best Practice 2: Cross-funktionale Teams und klare Rollen
In vielen Unternehmen arbeiten Fachabteilungen wie Entwicklung, Qualitätssicherung, Einkauf oder Produktmanagement noch immer weitgehend isoliert voneinander. Die Übergaben sind oft starr, der Informationsfluss bruchstückhaft, und Verantwortlichkeiten werden hin- und hergeschoben. Das Resultat: Missverständnisse, Verzögerungen und eine fragmentierte Sicht auf das Produkt.
Dabei ist längst erwiesen, dass komplexe Herausforderungen in der Produktentwicklung am besten von interdisziplinären Teams gelöst werden, die gemeinsam an einem Strang ziehen. Genau hier setzen cross-funktionale Teams an: Sie bringen alle relevanten Kompetenzen zusammen und fördern die ganzheitliche Verantwortung für ein Ergebnis.
Damit diese Zusammenarbeit nicht im Chaos endet, braucht es jedoch klare Strukturen und Regeln:
- Klare Rollenverteilung und abgestimmte Verantwortlichkeiten: Jeder im Team muss wissen, welche Aufgaben er übernimmt und wer in welchen Themen das letzte Wort hat. Doppelarbeiten oder Graubereiche lassen sich so vermeiden.
- Gemeinsame Zieldefinitionen und messbare KPIs: Wenn alle auf dieselben Ziele hinarbeiten wie etwa Time-to-Market, Produktqualität oder Kundenzufriedenheit, entsteht ein gemeinsames Verständnis von Erfolg. KPIs machen Fortschritt und Verantwortung sichtbar.
- Regelmäßiger Austausch durch etablierte Meeting-Strukturen: Agile oder hybride Formate wie Daily Standups, Review-Meetings oder Retrospektiven helfen, Informationen transparent zu teilen, Hindernisse früh zu erkennen und die Zusammenarbeit laufend zu verbessern.
Cross-funktionale Teams ermöglichen nicht nur eine bessere Abstimmung, sondern bringen auch verschiedene Perspektiven schon früh in die Lösungsfindung ein. Das steigert die Qualität der Entscheidungen, reduziert spätere Änderungen und erhöht ganz nebenbei auch die Identifikation aller Beteiligten mit dem Produkt.
Best Practice 3: Iteratives Arbeiten nach dem TwinPeaks-Prinzip
In der Theorie beginnt jede Produktentwicklung mit einem vollständigen Satz an Anforderungen, die anschließend systematisch umgesetzt werden. In der Praxis jedoch ist das selten der Fall, insbesondere bei innovativen oder technisch komplexen Produkten. Anforderungen sind häufig unvollständig, ändern sich im Projektverlauf oder hängen stark von technischen Lösungswegen ab, die zu Beginn noch gar nicht feststehen.
Genau hier setzt das TwinPeaks-Prinzip an. TwinPeaks ist ein iterativer Ansatz, bei dem Anforderungen und Architektur parallel entwickelt und gegenseitig verfeinert werden. Statt die Disziplinen sequenziell abzuarbeiten, entstehen beide „Gipfel“, also “Was soll das System leisten?” und “Wie könnte das technisch aussehen”, in engem Zusammenspiel und wiederholten Schleifen.
Die Vorteile dieses Vorgehens liegen auf der Hand:
- Frühe Rückkopplung zwischen Wunsch und Machbarkeit: Fachliche Anforderungen und technische Lösungsansätze werden frühzeitig miteinander abgeglichen, unrealistische Erwartungen werden schneller erkannt, technische Chancen frühzeitig genutzt.
- Schnelle Reaktion auf neue Erkenntnisse: Da nicht alles im Vorfeld final definiert sein muss, lassen sich neue Anforderungen, Erkenntnisse oder Risiken flexibel integrieren, ohne den gesamten Projektplan auf den Kopf zu stellen.
- Höhere Flexibilität in dynamischen Projektsituationen: Gerade bei externen Abhängigkeiten, sich ändernden Marktbedingungen oder unsicheren Rahmenbedingungen ist ein iterativer Ansatz deutlich robuster als klassische, phasenorientierte Vorgehensweisen.
- Gezielte Identifikation offener Punkte: Durch das Zusammenspiel von Anforderungen und Architektur zeigt sich frühzeitig, für welche Produktbestandteile noch offene Fragen bestehen und wofür weitere Anforderungen formuliert werden müssen. Dieser Ping-Pong-Prozess führt dazu, dass Lücken schneller sichtbar werden und gezielt geschlossen werden können, statt erst am Ende aufzufallen.
Wer nach dem TwinPeaks-Prinzip arbeitet, reduziert nicht nur den Planungsaufwand zu Projektbeginn, sondern erhöht gleichzeitig die Qualität und Umsetzbarkeit der Entscheidungen, weil diese schrittweise reifen und auf einem kontinuierlichen Abgleich zwischen Was und Wie basieren.
Best Practice 4: Durchgängige Digitalisierung und Tool-Unterstützung
Viele Probleme in der Produktentwicklung haben einen unscheinbaren, aber folgenreichen Ursprung: Medienbrüche. Anforderungen werden in Word-Dokumenten gesammelt, Architekturen in Visio skizziert, Tests in Excel verwaltet, während Entscheidungen per E-Mail abgestimmt und Freigaben irgendwo in Netzlaufwerken abgelegt werden. Das Resultat: Informationen sind verstreut, Versionen nicht nachvollziehbar und Zusammenhänge kaum erkennbar. Genau hier entstehen die Prozesslücken, die später zu Reibungsverlusten, Fehlern und hohem Abstimmungsaufwand führen.
Moderne Softwarelösungen wie reqSuite® rm helfen, diese Lücken zu schließen und den gesamten Entwicklungsprozess durchgängig digital abzubilden, von der Anforderung bis zum Test. Der Vorteil: Alle relevanten Informationen sind zentral verfügbar, miteinander verknüpft und über klar definierte Workflows steuerbar.
Konkret profitieren Sie durch Tool-Unterstützung von:
- Zentraler Verwaltung aller Anforderungen, Abhängigkeiten, Versionen und Freigaben: Keine Insellösungen mehr, stattdessen sind alle Inhalte konsistent dokumentiert und jederzeit nachvollziehbar.
- Verknüpfung mit Testfällen, Komponenten und Stakeholdern: Beziehungen zwischen fachlichen Anforderungen, technischen Bauteilen, Tests und beteiligten Personen werden explizit sichtbar und steuerbar gemacht.
- Automatisierte Benachrichtigungen und Workflows: Beteiligte werden aktiv über Änderungen, Freigaben oder Aufgaben informiert, was manuelle Abstimmungen reduziert und Entscheidungen beschleunigt.
- Intelligente Assistenzfunktionen zur Qualitätssicherung: Moderne Tools wie reqSuite® rm bieten KI-basierte Prüfungen auf Vollständigkeit, Konsistenz oder potenzielle Konflikte und stellen dadurch einen echten Mehrwert für strukturierte Projekte dar.
Digitalisierte Prozesse sind nicht nur schneller und transparenter, sondern auch deutlich robuster gegenüber menschlichen Fehlern. Sie machen es einfacher, Standards einzuhalten, Änderungen kontrolliert umzusetzen und Projekte zuverlässig zu skalieren, was gerade in wachsenden oder stark regulierten Unternehmen notwendig ist.
Best Practice 5: Kontinuierliche Verbesserung etablieren
Auch der beste Prozess ist nie fertig, denn Rahmenbedingungen, Technologien und Anforderungen verändern sich ständig. Unternehmen, die ihre Produktentwicklung dauerhaft erfolgreich gestalten wollen, brauchen deshalb mehr als einmalige Optimierungen. Sie brauchen eine gelebte Kultur der kontinuierlichen Verbesserung.
Das bedeutet: Prozesse und Strukturen werden regelmäßig reflektiert, hinterfragt und angepasst. Nicht jedoch aus Aktionismus, sondern immer mit dem Ziel, systematisch besser zu werden. Diese Haltung unterscheidet reife Organisationen von solchen, die nur auf Probleme reagieren, wenn es schon zu spät ist.
Wichtige Elemente dieser kontinuierlichen Verbesserung sind:
- Retrospektiven nach Projektphasen oder Releases: In kurzen, strukturierten Rückblicken analysiert das Team, was gut gelaufen ist, wo es gehakt hat und was künftig anders gemacht werden sollte.
- Systematisches Einholen von Feedback aus allen Rollen: Nicht nur Entwickler oder Projektleiter, sondern auch Fachbereiche, Tester und externe Stakeholder sollten regelmäßig Gehör finden, denn jeder Blickwinkel zählt.
- Kennzahlenbasierte Analyse: Daten wie Durchlaufzeiten, Fehlerquoten oder Änderungsbedarfe helfen, Schwachstellen objektiv zu erkennen und Verbesserungsmaßnahmen gezielt abzuleiten.
- Mut zur Veränderung: Eine echte Verbesserungskultur braucht Offenheit, insbesondere auch für unbequeme Fragen. Nur wer den Status quo regelmäßig hinterfragt, kann langfristig resilient und innovativ bleiben.
Kontinuierliche Verbesserung ist daher kein optionales Extra, sondern ein zentraler Erfolgsfaktor in einer sich wandelnden Welt. Wer kontinuierlich reflektiert, bleibt resilient, innovativ und wettbewerbsfähig.
Effiziente Produktentwicklung ist kein Zufall
Die Verbesserung von Prozessen in der Produktentwicklung erfordert keine radikale Neuausrichtung, wohl aber ein strukturiertes Vorgehen, klare Rollenverteilungen und die konsequente Nutzung moderner Werkzeuge.
Mit den vorgestellten Best Practices legen Sie ein solides Fundament:
- Professionelles Anforderungsmanagement
- Cross-funktionale Zusammenarbeit mit klaren Rollen
- Iteratives Vorgehen mit TwinPeaks
- Durchgängige Digitalisierung
- Gelebte Verbesserungskultur
OSSENO unterstützt Sie dabei, diese Best Practices praxisnah umzusetzen. Egal ob Sie gerade erst starten oder bestehende Prozesse modernisieren wollen: Wir helfen Ihnen, Ihre Produktentwicklung effizienter, transparenter und zukunftssicher zu gestalten. Damit Ihre Teams nicht härter, sondern intelligenter arbeiten!
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wo bei Ihnen der größte Hebel liegt.
Vereinbaren Sie jetzt eine kostenfreie Demo und erleben Sie, wie moderne Prozessunterstützung in der Produktentwicklung aussieht.
Über den Autor

Neele Borkowsky
Marketing Managerin
Neele Borkowsky ist seit knapp drei Jahren als Marketing Managerin bei der OSSENO Software GmbH tätig und versteht genau, mit welchen Herausforderungen und Unsicherheiten Unternehmen konfrontiert sind, die noch keine Lösung für ihr Requirements Engineering nutzen. Durch den engen Austausch mit Interessenten und Kunden aus verschiedenen Branchen weiß sie, worauf es bei der Wahl des richtigen Anforderungsmanagement-Tools ankommt und welchen Mehrwert reqSuite® rm bieten kann.
Weitere interessante Artikel

Wissen
5
Min. Lesedauer
Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen

Johanna Lotter
9.2.2026
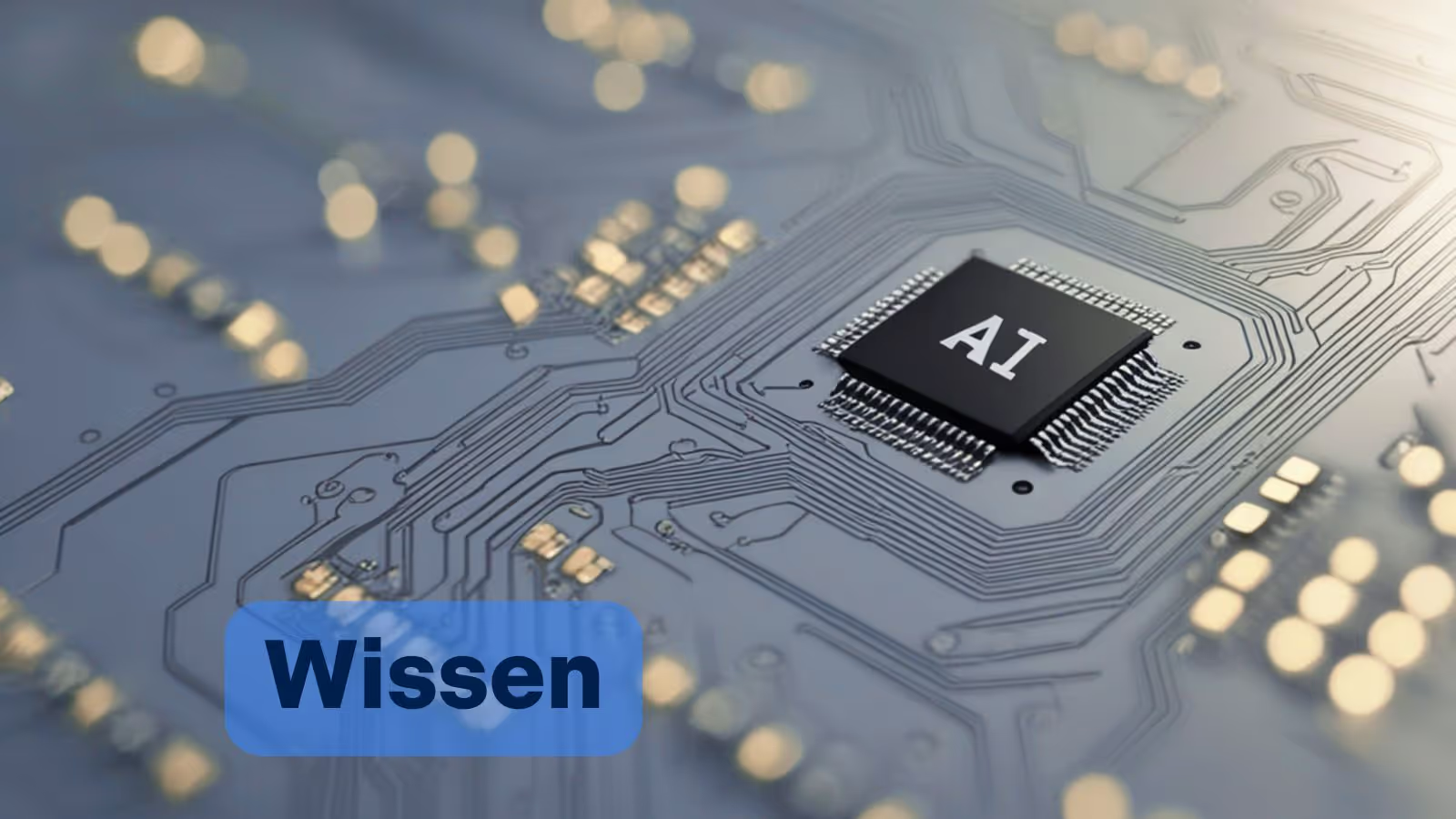
Wissen
15
Min. Lesedauer
Automatische Importierung und KI-basierte Bewertung von Anforderungen in RM-Tools

Dr. Sebastian Adam
28.1.2026
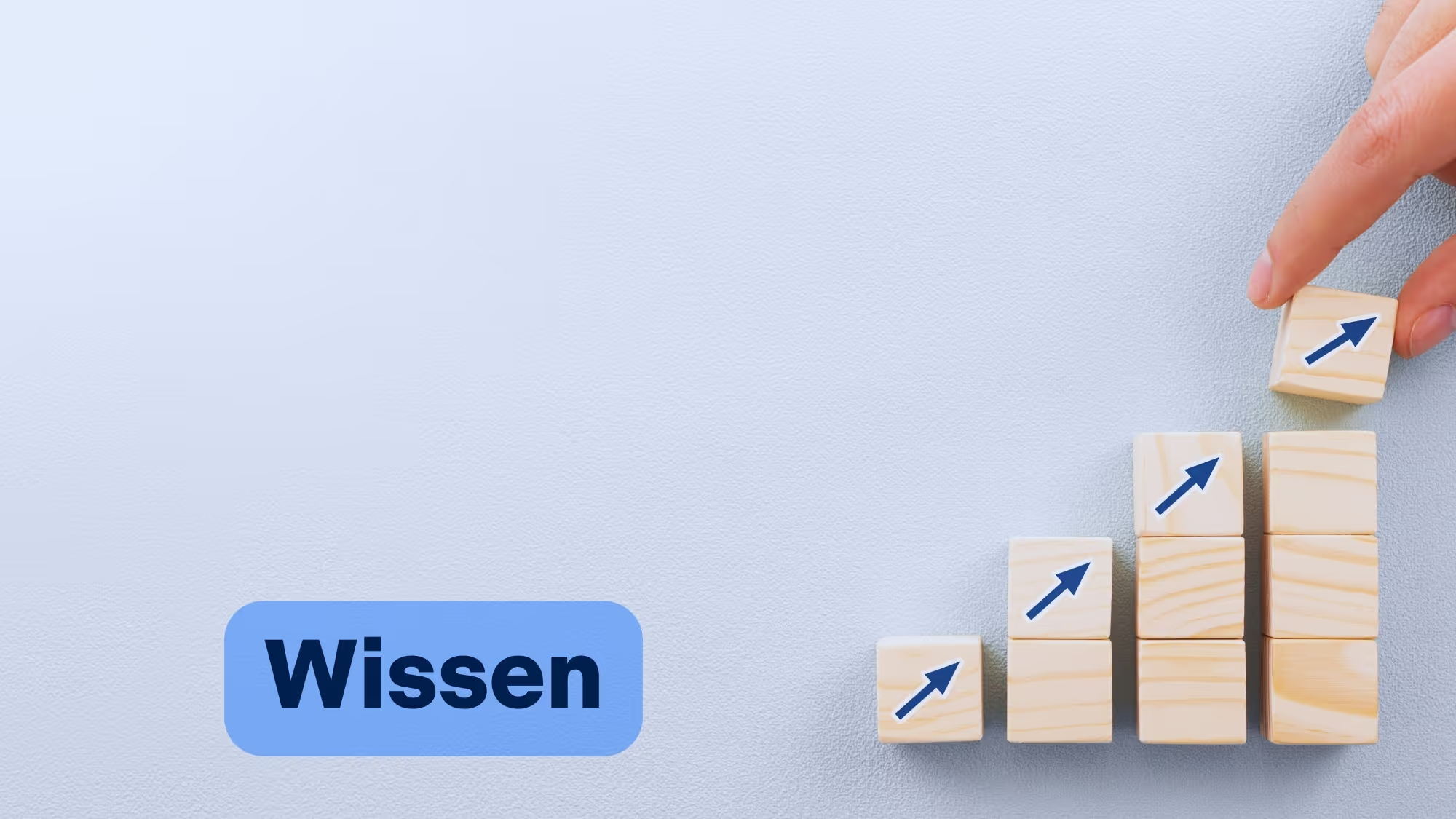
Wissen
8
Min. Lesedauer
Was einen guten Anforderungsmanagement-Prozess auszeichnet

Dr. Sebastian Adam
14.1.2026












