Warum externe Berater selten das passende RM-Tool finden und wie es besser geht
11.9.2025
9
Min. Lesedauer

1. Fehlendes Verständnis für Anforderungen, Strukturen und Realität
Requirements Management ist nicht bloß ein Tool-Thema. Es ist ein Abbild der Arbeitsweise, des Denkens und der Produktstruktur eines Unternehmens. Ein RM-Tool greift tief in Prozesse ein: von der Art, wie Anforderungen entstehen, über die Kommunikation zwischen Abteilungen bis hin zur Frage, wie Entscheidungen dokumentiert und nachvollziehbar gemacht werden.
Genau hier liegt jedoch das Kernproblem. Externe Berater kennen die Organisation nur oberflächlich und vielleicht ein paar andere Unternehmen aus der Branche. Sie sehen ausgewählte Dokumente, sprechen mit einigen Schlüsselpersonen, werfen einen Blick ins Organigramm, doch all das bleibt eine Momentaufnahme. Was sie nicht wirklich erfassen, sind die vielen unsichtbaren Faktoren: wie Entscheidungen tatsächlich getroffen werden, wo Reibungsverluste im Alltag entstehen oder welche Abstimmungswege informell, aber entscheidend sind.
Hinzu kommt: Unternehmensrealität ist oft widersprüchlich. Neben fachlichen Anforderungen spielen Budgetgrenzen, politische Rahmenbedingungen, bestehende IT-Landschaften oder auch persönliche Präferenzen von Entscheidern eine Rolle. Berater können diese Aspekte kaum in der Tiefe erfassen; schlicht, weil sie nicht im Tagesgeschäft eingebunden sind.
Das Ergebnis ist fast immer dasselbe: Es werden Tools empfohlen, die auf dem Papier gut aussehen, in PowerPoint-Folien überzeugen und in allgemeinen Vergleichstabellen glänzen, die aber in der Praxis entweder überdimensioniert sind, nicht durchsetzbar erscheinen oder schlicht nicht zu den tatsächlichen Arbeitsweisen des Unternehmens passen.
Die Folge ist ernüchternd: Statt Entlastung und Klarheit bringt die Einführung mehr Diskussionen, Widerstände und Anpassungskosten, als ursprünglich erwartet wurde.
2. Fokus auf Funktionen statt auf echte Unterstützung
Ein weiterer typischer Fehler in extern begleiteten Auswahlprozessen: Berater erstellen riesige Kriterienkataloge – manchmal mit über 100 Punkten – und prüfen dann, welches Tool wie viele Häkchen bekommt. Am Ende wirkt die Lösung mit den meisten Häkchen automatisch wie die beste Wahl.
Doch genau hier liegt der Denkfehler. Was dabei verloren geht, ist die entscheidende Frage: Kann das Tool unsere eigene Arbeitsweise sinnvoll unterstützen?
Denn die Kernfrage lautet eben nicht: Hat das Tool diese Funktion?
Sondern: Wie gut ist diese Funktion umgesetzt und passt sie wirklich zu unserem Vorgehen, zu unserer Organisation, zu unseren Menschen?
Gerade bei RM-Tools ist das besonders kritisch. Ihr Nutzen zeigt sich nicht in der reinen Oberfläche oder in der Anzahl an Features, sondern in der Tiefe:
- Wie flexibel lässt sich die Struktur an die eigene Produktlogik anpassen?
- Wie klar sind Beziehungen und Abhängigkeiten modellierbar?
- Wie stark unterstützt das Tool die tägliche Arbeit – statt zusätzlichen Aufwand zu erzeugen?
Das sind Fragen, die sich nicht mit einem Excel-Sheet beantworten lassen. Ein Spreadsheet kann messen, ob eine Funktion existiert, aber nicht, ob sie praktikabel ist. Und auch ein kurzer Blick in eine Demoversion reicht nicht, um zu spüren, ob das Tool im Alltag wirklich trägt.
Die Folge: Unternehmen landen bei Tools, die zwar theoretisch „passen“, in der Praxis aber entweder zu komplex oder zu einfach sind, sodass sie nie wirklich wertstiftend eingesetzt werden können.
3. Zwischen Voreingenommenheit und Beliebigkeit: Der falsche Fokus vieler Berater
Unsere Erfahrung zeigt: Die Qualität einer Toolauswahl hängt stark vom Berater-Typ ab. Leider begegnen uns dabei immer wieder zwei Extreme und beide sind gleichermaßen problematisch.
- Die Voreingenommenen:
Sie arbeiten bevorzugt mit den Tools, die sie ohnehin kennen. Manchmal, weil sie an Partnerschaften oder Provisionen verdienen. Manchmal einfach, weil sie sich darin sicher fühlen und ungern Neuland betreten. Die Folge: Statt einer objektiven Analyse bekommen Unternehmen eine vorgeprägte Empfehlung, unabhängig davon, ob diese Lösung wirklich passt. - Die Weitgefassten:
Sie nehmen alles in die engere Wahl, was der Markt hergibt. Projektmanagement-Tools, Wiki-Systeme, Ticketlösungen mit „Requirements-Modul“ – Hauptsache, die Liste ist lang. Das hat mit echter Passung wenig zu tun, erhöht aber den Beratungsumfang und damit das Honorar.
Das Entscheidende, das viele übersehen: Die Tool-Landschaft im Bereich Requirements-Management ist gar nicht so groß.
Im deutschsprachigen Raum gibt es vielleicht ein gutes Dutzend ernstzunehmender Lösungen. Der Rest sind Werkzeuge, die Anforderungen nur am Rande abbilden können, aber nie die Tiefe und Logik eines echten RM-Tools erreichen.
Die Herausforderung liegt also nicht in der Menge der Optionen, sondern darin, die tatsächliche Passung zu erkennen:
- Wie gut spiegelt das Tool die spezifischen Prozesse des Unternehmens wider?
- Wie klar lässt es sich in bestehende IT-Landschaften integrieren?
- Und vor allem: Wie gut funktioniert es in der Praxis mit den Menschen, die es später täglich nutzen sollen?
Diese Fragen lassen sich nicht mit Voreingenommenheit oder Beliebigkeit beantworten, sondern nur mit echtem Praxisbezug. Genau hier scheitern viele Beratungsansätze – weil sie versuchen, eine Entscheidung über Tabellen und Standardkriterien zu treffen, die eigentlich im realen Projektumfeld gefällt werden müsste.
4. Wenn Informationen auf der Strecke bleiben
Ein weiteres oft unterschätztes Problem: Berater sind Übersetzer zwischen Hersteller und Kunde, und dabei geht regelmäßig etwas verloren.
In Auswahlprozessen führen Berater Gespräche mit Tool-Anbietern, lassen sich Funktionen erklären und versuchen, diese Erkenntnisse für das Unternehmen aufzubereiten. Doch gerade bei komplexeren Themen passiert es häufig, dass wichtige Details falsch verstanden oder vereinfacht dargestellt werden.
Die Folgen sind gravierend:
- Eine Lösung, die eigentlich genau die richtige gewesen wäre, wirkt auf den Kunden plötzlich unpassend, nur weil ein entscheidender Aspekt nicht korrekt vermittelt wurde.
- Oder umgekehrt: Ein Tool erscheint attraktiv, weil Schwächen gar nicht erst angesprochen oder schlicht übersehen wurden.
Das passiert nicht aus böser Absicht, sondern weil Requirements Management ein tiefes Fachgebiet ist, das man nicht „nebenbei“ in seiner ganzen Tragweite erfassen kann. Wenn Berater versuchen, hochspezialisierte Konzepte in allgemeinen Management-Sprech zu übersetzen, entsteht oft ein Zerrbild und die eigentliche Stärke oder Schwäche eines Tools bleibt verborgen oder wird sogar ins Gegenteil verkehrt.
Am Ende bekommt das Unternehmen nicht die vollständige Wahrheit, sondern eine gefilterte Version, und trifft seine Entscheidung auf Basis unvollständiger oder verfälschter Informationen.
Wie es besser geht: Berater einbinden – aber nicht entscheiden lassen
Nicht falsch verstehen: Externe Berater können sehr hilfreich sein. Sie bringen wertvolle Impulse, helfen, blinde Flecken zu vermeiden und Anforderungen systematisch zu erfassen. Sie können den Auswahlprozess strukturieren, auf typische Stolpersteine hinweisen und sicherstellen, dass kein wichtiger Aspekt übersehen wird.
Aber: Sie sollten nicht diejenigen sein, die Tools vergleichen, bewerten oder gar eine Vorauswahl treffen.
Warum?
- Weil sie nicht diejenigen sind, die später mit dem Tool arbeiten müssen.
- Weil sie die internen Widerstände, politischen Dynamiken und echten Bedürfnisse nicht kennen.
- Und weil sie am Ende nicht dafür einstehen, ob das Tool wirklich genutzt wird oder wieder in der Schublade verschwindet.
Die Verantwortung für die Toolauswahl muss also im Unternehmen selbst bleiben. Berater sind wertvolle Unterstützer, aber sie dürfen nicht die Entscheider sein.
Drei Prinzipien für eine gute Toolauswahl
Damit ein Anforderungsmanagement-Tool wirklich Mehrwert stiftet und nicht zum Papiertiger wird, sollte die Auswahl drei klaren Prinzipien folgen:
1. Interne Beteiligung statt Delegation
Ein RM-Tool verändert die tägliche Arbeit vieler Rollen – vom Produktmanagement über die Anforderungsanalyse bis hin zu Systemarchitektur, Entwicklung und Test. Deshalb gilt: Wer später mit dem Tool arbeiten soll, muss von Anfang an eingebunden sein.
Praktisch bedeutet das: Die relevanten Rollen schauen sich die Tools selbst an, diskutieren gemeinsam und bringen ihre Sichtweisen ein. So entsteht Akzeptanz und die Wahrscheinlichkeit, dass das Tool auch wirklich genutzt wird, steigt erheblich.
2. Fokus auf Prozesskompatibilität statt Funktionslisten
Der entscheidende Maßstab ist nicht die Anzahl der Features, sondern die Passung zum eigenen Vorgehen.
Ein mittelgroßes Tool, das die eigene Arbeitsweise präzise unterstützt, ist in der Praxis wertvoller als ein riesiger Werkzeugkasten, in dem sich niemand zurechtfindet, aber auch besser als ein einfaches Out-of-the-Box-Tool, das den Eindruck vermittelt, als könne man direkt starten.
Statt also Funktionslisten abzuhaken, sollte die Frage im Vordergrund stehen: Wie gut bildet das Tool unsere Strukturen, Prozesse und Denkweise ab?
3. Anbieter in die Pflicht nehmen
Gute Hersteller erkennen schnell, ob ihr Tool passt oder nicht – und sagen das auch. Dieses Wissen sollte man aktiv nutzen. Statt Testaccounts blind durchzuspielen, ist der Dialog entscheidend:
- Welche Strukturen habt ihr heute?
- Wie arbeitet ihr aktuell?
- Wo liegen die größten Engpässe?
- Was soll sich verbessern?
Anbieter, die zuhören, mitdenken und konkrete Lösungsvorschläge machen, sind die wertvollsten Partner. Denn sie haben das tiefste Verständnis für ihr eigenes Tool und können daher am besten einschätzen, ob es wirklich passt.
Requirements Management ist zu wichtig, um es auszulagern
Die Einführung eines RM-Tools ist kein klassisches IT-Projekt, das man wie einen Server oder eine Standardsoftware einfach einkaufen kann. Es ist eine Investition in bessere Produktentwicklung, klarere Kommunikation und weniger Reibungsverluste.
Deshalb darf diese Entscheidung nicht an externe Berater delegiert werden. Zu groß ist die Gefahr, dass am Ende ein Tool gewählt wird, das auf dem Papier überzeugt, in der Praxis aber nicht trägt.
Heißt das, Berater seien überflüssig? Keineswegs, denn sie können wertvolle Unterstützung leisten. Aber: Die Rollen müssen klar verteilt sein. Die Verantwortung für die Auswahl liegt bei den Menschen im Unternehmen, die später mit dem Tool arbeiten und die internen Rahmenbedingungen kennen.
Ein oft gehörtes Gegenargument lautet: „Wir werden ja schon selbst entscheiden, aber die Vorauswahl sollen erst mal Berater machen.“
Das klingt nach einem guten Kompromiss, ist es aber nicht. Denn die entscheidende Weiche wird bereits in der Vorauswahl gestellt. Wenn hier die falschen Tools herausfallen, sehen die Mitarbeitenden sie nie, und haben somit gar keine Chance, die beste Lösung überhaupt in Betracht zu ziehen.
Genau an dieser Stelle passieren auch die größten Fehler: Ein Tool, das in der Praxis perfekt passen würde, wird aussortiert, nur weil ein Berater es nicht kennt, nicht richtig verstanden hat oder weil es nicht in eine standardisierte Bewertungsmatrix passte.
Die richtige Vorgehensweise lautet deshalb: Berater als Sparringspartner einbinden, aber die Vorauswahl, Bewertung und finale Entscheidung konsequent im eigenen Haus verankern. Ergänzend dazu kann der Austausch mit den Toolexperten selbst wertvolle Impulse liefern und einen Einblick in vergleichbare Einführungssituationen geben.
Gute Entscheidungen entstehen dann, wenn internes Wissen über die eigene Realität auf genau diese Praxiserfahrung trifft.
Und nur wer diesen Weg von Anfang an aktiv mitgeht, wird das Tool später auch wirklich nutzen – nicht, weil er muss, sondern weil er überzeugt ist.
Über den Autor

Dr. Sebastian Adam
Geschäftsführer & Mitgründer
Dr. Sebastian Adam beschäftigt sich seit über 20 Jahren intensiv mit Anforderungsmanagement. Sein Wissen und seine Erfahrung machen ihn zu einem anerkannten Experten, wenn es um die Herausforderungen und Best Practices in diesem Bereich geht. 2015 gründete er die OSSENO Software GmbH, um Unternehmen dabei zu helfen, ihr Anforderungsmanagement einfacher, effizienter und zukunftssicher zu gestalten. Mit reqSuite® rm, der von ihm entwickelten Software, hat er eine Lösung geschaffen, die Unternehmen dabei unterstützt, Anforderungen strukturiert zu erfassen, zu verwalten und nachhaltig zu verbessern. Sein Anspruch: Praxistaugliche Methoden und moderne Technologien zusammenbringen, um Unternehmen wirklich weiterzuhelfen.
Weitere interessante Artikel

Tipps
12
Min. Lesedauer
Das perfekte Anforderungsmanagement-Tool finden: So vermeidest Du häufige Fehler

Dr. Sebastian Adam
17.8.2024
.avif)
Tipps
10
Min. Lesedauer
Warum Jira kein Anforderungsmanagement-Tool ist

Dr. Sebastian Adam
7.3.2025
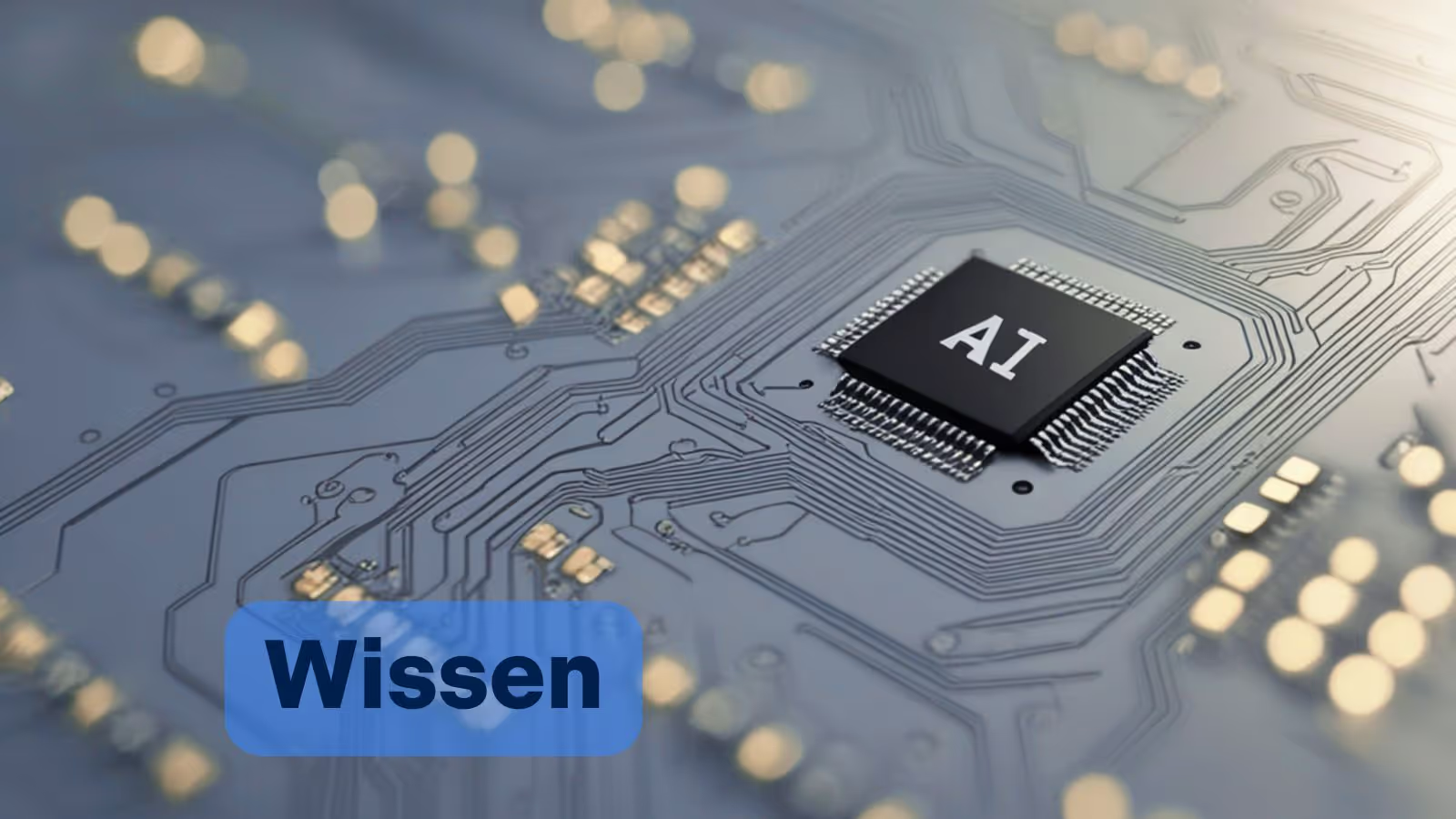
Wissen
15
Min. Lesedauer
Automatische Importierung und KI-basierte Bewertung von Anforderungen in RM-Tools

Dr. Sebastian Adam
3.2.2026
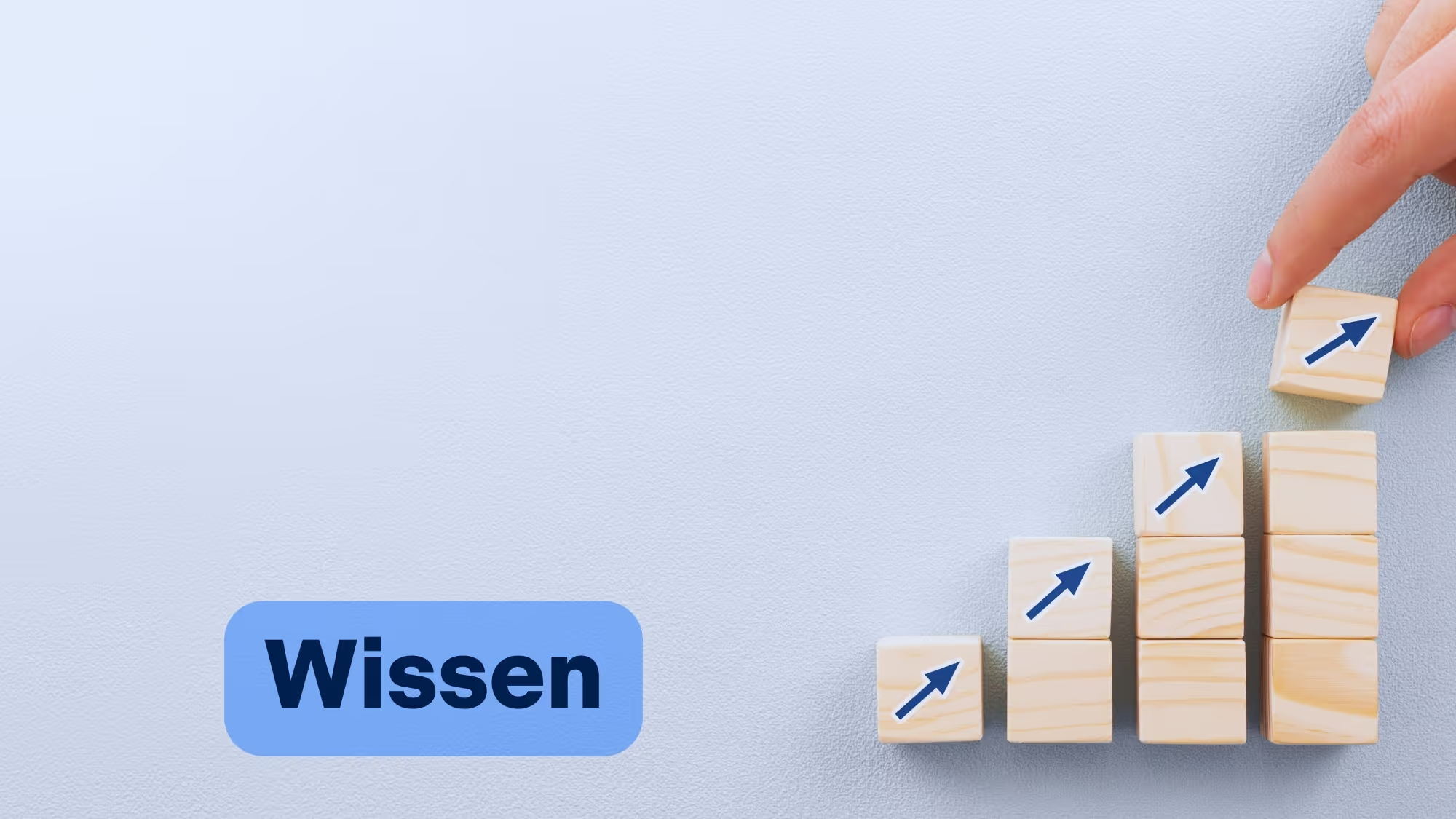
Wissen
8
Min. Lesedauer
Was einen guten Anforderungsmanagement-Prozess auszeichnet

Dr. Sebastian Adam
14.1.2026
.avif)
Tech
5
Min. Lesedauer
reqSuite® rm 4.7 – Alle Neuerungen im Überblick

Phil Stüpfert
12.12.2025












